"Ist der Wettbewerb
das Rauschgift
der Baukultur?"
Ja! 56%
Nein! 44%

Architekturwettbewerbe gelten als Königsweg der Architektur. Sie werden veranstaltet, wenn für eine anstehende Bauaufgabe der beste Entwurf hinsichtlich Funktion, Ökonomie, Ästhetik und vieler weiterer zum Teil divergierender Anforderungen, gefunden werden soll. Hält sich der Auslober am Ende an die Vorgaben der Jury und das preisgekrönte Projekt wird realisiert, was nicht immer der Fall ist, sind alle glücklich. Ausgenommen natürlich die vielen Architekten, die ihren Beitrag eingereicht haben und leer ausgegangen sind.
Das ist die Crux und das ist das wesentliche Argument, das dem offenen Architektenwettbewerb oft entgegengehalten wird. Es gibt immer nur einen Gewinner und viele Verlierer. Vom unternehmerischen Standpunkt aus sei dies unverantwortlich, so hört man immer wieder und gesamt volkswirtschaftlich grenze eine solche Verschwendung von Arbeitskraft an Wahnsinn. Kann schon sein.
Vom unternehmerischen Standpunkt aus ist das Wettbewerbswesen nicht unbedingt verkehrt. Viele Architekten schätzen es, ihr kreatives Potenzial zu trainieren und sich mit ihren Mitbewerbern im Wettkampf zu messen. Denn wo sonst hat ein Architekt die Gelegenheit seine eigene Kreativität auszuleben als im Wettbewerb? Von der Präsenz des eigenen Büros in der Wettbewerbsszene verspricht sich manch einer eine werbewirksame Außenwirkung, denn die Medien publizieren gerne die Wettbewerbsergebnisse. Wer dabei ist, gehört dazu – zumindest einen kurzen Rausch lang – und wer dazu gehört, ist wichtig. Und auch die immer wieder beschworene volkswirtschaftliche Verschwendung von Kreativpotenzial, die dem Wettbewerbswesen innewohnt, kann man durchaus sportlich sehen. Es ist für jeden Architekten immer eine unternehmerische Entscheidung, wie viel er in Wettbewerbsverfahren investieren will und jeder muss für sich selbst abwägen, ob es sich für ihn lohnt oder nicht. Wenn manch einer zehnmal pro Jahr in den Ring steigt und dabei einen gewonnenen Wettbewerb realisiert, kann man durchaus von einer erfolgreichen Strategie sprechen.
Der eigentliche Wahnsinn ist bei dieser vordergründigen Betrachtung aber noch gar nicht zur Sprache gekommen. Es herrscht zwar ein Konsens darüber, dass der Wettbewerb gut für die Architektur ist. Gute Architektur allein macht aber noch keine Baukultur. Denn wie das Wort bereits sagt, beschreibt der Begriff die Kultur, in der gebaut wird. Das schließt die Bedingungen, unter denen geplant wird, mit ein. Unsere Baukultur wird heute nicht unerheblich davon geprägt, dass das Angebot an Architektenleistungen größer als die Nachfrage ist. Architekten arbeiten heute in einem gesättigten Markt.
Diese Situation wird durch Wettbewerbe eher verschärft als überwunden, denn in einem Wettbewerb gibt es naturgemäß auch immer nur einen Gewinner. Das Wettbewerbswesen, das auf dem Prinzip der Konkurrenz beruht, ist deshalb ein genaues Abbild der Marktsättigung.
Ist da die Suche nach dem Besten anhand des Architektenwettbewerbs wirklich die richtige Antwort oder ist der Wettbewerb vielmehr der Teufel, mit dem der Beelzebub ausgetrieben werden soll? Wird die Marktsättigung nicht erst überwunden, wenn der Markt komplexer wird und wenn Architekten erkennen, was sie voneinander unterscheidet? Wäre es für den Berufsstand nicht zukunftsweisender zu beginnen, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, Communities aufzubauen, wie es beispielsweise in den Baugruppen geschieht? Schreibt die Suche nach der besten Architektur nicht das Strukturproblem eines ganzen Berufstands fort und betäubt die schmerzhaften Symptome mit reichlich Glamour? Ist der Wettbewerb also das Rauschgift der Baukultur?
Diese Debatte wird gastkuratiert von Elke Anna Mehner und Volker Eich vom Strategiekreis Architekten. Volker Eich hat DAS STRATEGIEBUCH FÜR ARCHITEKTEN geschrieben.
Jein ...
Ja ...
Jein ...
Nein ...
Nein ...
Jein ...
Nein ...
Nein ...
Jein ...
Nein ...
Nein ...
Ja ...
Jein ...
Ja ...
Ja ...
Nein ...
Jein ...
Ja ...
Nein ...
Ja ...
Ja ...
Nein ...
Ja ...
Nein ...
Nein ...
Ja ...
Nein ...
Ja ...
Nein ...
Erstens: Das Führen eines Architekturbüros ist eine unternehmerische Leistung und dazu gehört, dass in einem vermeintlich gesättigten Markt Konkurrenz das Mittel ist, um die guten von den schlechten Ideen zu unterscheiden.
Zweitens: Soll diese Unterscheidung aufgrund architektonischer Qualität erfolgen, sind Architekturwettbewerbe mit ausgewiesenen Fachjurys immer noch das beste Instrument dazu.
Drittens: Nicht jede Bauherrenschaft ist eine qualifizierte Bauherrenschaft. Bauherren müssen professionalisiert und beraten werden und das leistet eine Fachjury. Wenn Architekturbüros sich auf Bauherrenberatung spezialisieren, wie z. B. Begleitung von Baugruppen, ist das gut, ersetzt aber nicht den Prozess, das jeweils beste Projekt auszuwählen.
Viertens: Gegen die Spezialisierung von Architekturbüros auf bestimmte Themen und Bauaufgaben, die bestimmte Kunden oder „Communities“ bedienen, ist nichts zu sagen. Als öffentliche Bauherrin wünsche ich mir natürlich kompetente Wohnungsbauerinnen, Schulhausbauer, Opernbauer oder Denkmalsaniererinnen. Aber aufgepasst, wir sollten nicht in technokratische Zustände zurückfallen, indem z. B. Spitalplaner oder Institutsplaner quasi konkurrenzlos an Aufträge kommen, denn das leistet unserer Architekturproduktion einen Bärendienst . Auch bei berechtigter „Spezialisierung“ ist Ideenkonkurrenz ein wichtiger Faktor für Innovation. Ohne die hätten z. B. Herzog & de Meuron nie ein atemberaubendes humanes Reha-Zentrum für Paraplebiker in Basel gebaut.
Fünftens: Architekturwettbewerbe bieten eine Plattform, Talente sichtbar zu machen. Es ist eine mögliche, aber sicher nicht die einzige Form der „Partnerbörse“ zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
Sechstens: Architekturwettbewerbe sind eine Form, die den Dialog zwischen Bauherren, Behörden und Architekten transparenter machen und die zukünftigen Partner für einen bevorstehenden, oft noch steinigen Umsetzungsprozess zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen zu kitten.
Siebtens: Baukultur ist Dialogkultur. Wo wird seriöser und versierter über Projekte und Bauaufgaben diskutiert als in einem Preisgericht?
Regula Lüscher studierte an der ETH Zürich Architektur und war zunächst im eigenen Architekturbüro tätig. 1998 wechselte sie in das Amt für Städtebau der Stadt Zürich, und war dort von 2001 bis 2007 als stellvertretende Direktorin tätig. Seit 2007 ist Lüscher Senatsbaudirektorin im Range einer Staatssekretärin in Berlin. Zudem ist sie Aufsichtsratmitglied mehrer Wohnungsbaugesellschaften und Honorarprofessorin an der Universität der Künste in Berlin.
5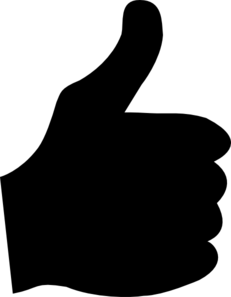
4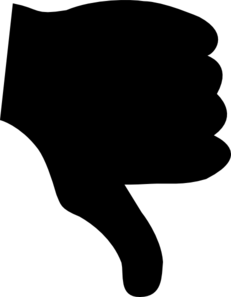
2



Gabor Kovacs / 8.10.2013 / 21:45
Ja ...
Volker Eich und Elke Anna Mehner / 14.10.2013 / 12:25
Jein ...