"Braucht gute Architektur Bauvorschriften?"
Ja! 61%
Nein! 39%

{For English please scroll down}
Jaques Herzog hat einmal in einem Interview gesagt, “dass die meisten Architekten gar nicht fähig sind, mit einer Tabula-rasa-Situation etwas anzufangen. Die Einschränkungen und Vorgaben sind für die meisten Architekten das, woran sie sich mangels Fähigkeiten festhalten und woran sie ihr Ding festmachen können“.
Andererseits sind Regeln sind natürlich auch dazu da, gebrochen zu werden. Paul Goldberger meinte dazu in der New York Times sogar einst: „Maybe the best test of a good architect is his or her ability to break the rules and get away with it.“ Es gibt unzählige architektonische Beispiele, die deutlich machen, dass herausragende bauliche Lösungen oft nur dank der hartnäckigen Auseinandersetzung mit Vorschriften und Regeln möglich wurde. Zeitschriften widmen dem Thema ganze Ausgaben, wie z.B. die Bauwelt.
Reibungsfläche sind dabei einerseits Normen und andererseits baurechtliche Vorschriften oder Regeln. Erstere sind insbesondere im Wohnungsbau der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (und später mit dem Protagonisten Ernst Neuffert) eine Errungenschaft zur Qualitätssicherung des Lebensstandards der breiten Bevölkerung. Sie fliessen ein in baurechtliche Vorschriften, bzw. Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, das als politisches Steuerungsinstrument dient, und regelt, ob, was, wie und wieviel gebaut werden darf.
Aber gerade im Wohnungsbau müssen Normen und Regeln immer wieder an die aktuelle gesellschaftliche Situation angepasst werden. Wenn dies nicht geschieht, bleibt Architekten, die sie in kritischer Ausübung ihres Berufes hinterfragen, nichts anderes übrig als sie umzudeuten oder regelrecht auszutricksen. Ohne das Auffinden des gesetzlichen Schlupflochs oder ohne den legalen Regelverstoß durch die Architekten würde heute weder der Tour Bois le Prêtre von Druot, Lacaton & Vassal in Paris noch stehen, noch wäre je die Sargfabrik in Wien (link zum Projekt) entstanden. Standards, die einst zur Qualitätssischerung aufgestellt wurden, können heute zum Beispiel die Erstellung kleinerer und damit günstigerer Wohnungen verhindern. Auch Flächennutzungspläne oder Gestaltungssatzungen fordern Architekten heraus, ihre eigenen Antworten darauf zu finden. Doch wird der Akt der konstruktiven Überschreitung oft genug mit Ausschluss oder Verstümmelung bestraft – man denke an das vermeidbare Schicksal von Nicholas Grimshaws „Gürteltier“, das an der Straßenseite per behördlicher Anordnung auf 22m-Traufhöhe und Blockrandbebauung getrimmt wurde.
Aber darüber zu jammern hilft nicht. Architekten müssen eine aktivere Rolle im Prozess der Normierung und Regelung des Bauens einnehmen. Normen und Bauvorschriften sind bekanntlich nicht gottgegeben, sondern werden von Menschen mit bestimmten Interessen gemacht. Waren das anfänglich eher die politischen Vertreter der Bevölkerung, so haben sich hier in den letzten Jahrzehnten immer mehr die Lobbyvertreter der Bauindustrie ins Spiel gebracht. Immer öfter schreiben sie ihre geschäftlichen Anliegen ganz unverhohlen in die Gesetzesentwürfe, die von den Gesetzgebern nicht selten nur noch durchgewunken werden – man denke an die EnEV, die den Bedürfnissen der Dämmstoffindustrie verbindlichst entgegenkommt. Auf diese Weise ist ein Wust an Vorschriften entstanden, der den einst archaischen Akt des Bauens heute so verkompliziert, dass Architekten immer mehr Zeit damit verbringen, die große bahnbrechende Idee, mit der man den Wettbewerb gewann, auch nur halbwegs unversehrt durch das scharfzackige Heckenwerk unzähliger Paragraphen aus kommunalen, föderalen, Bundes- und europäischen Richtlinien zu bugsieren. Der Architekt wandelt sich langsam vom Entwerfer zum wandelnden Behördenflüsterer. Immer lauter wird der Ruf, die Überregulierung des Bauens zu stoppen. Braucht gute Architektur also Bauvorschriften?
Aktuelle Anmerkung der Redaktion: Angestoßen durch den Britischen Pavillon der letzten Architektur Biennale in Venedig wird das Thema seit einiger Zeit auch in Großbritannien diskutiert (siehe: The Guardian) Und am 5. 3. fand am Royal Institute of British Architects in London ein von Liam Ross organisiertes Symposium zum Thema statt.
Does good architecture need regulations?
Jacques Herzog once said in an interview that: “Most architects are not even capable of dealing with a tabula rasa situation. Restrictions and regulations are what most architects hold on to, for lack of capabilities, in order to anchor their designs somewhere.“
But rules are meant to be broken they say. Former New Yorker architecture critic Paul Goldberger once went as far as saying: “Maybe the best test for a good architect is his or her ability to break the rules and get away with it.“ There are many examples of outstanding architectural designs that only came into being by negotiating, bypassing or even breaking existing regulations. Magazines, like the German Bauwelt, dedicate entire issues to this topic.
Friction is not only caused by general norms but also by regulations or rules. Norms, especially those of housing during the first half of the 20th century, were once used as tools for guaranteeing a good quality of life for the majority of the population. They have been moulded into building code and planning law that today serve as political instruments to regulate what, how, and how much can be built.
But norms and rules have to be adapted continuously to changing social conditions, especially in housing. If this does not happen, then architecture in pursuit of a critical practice will have no other choice but to artfully misinterpret them to reach a perfectly desirable design solution. Without the sophisticated search for legal loopholes, a building like Tour Bois le Prêtre in Paris, recently ingeniously transformed by Druot, Lacaton & Vassal, would no longer exist. An equally inventive project, like BKK-3’s Sargfabrik in Vienna, would never have been built in the first place. The same social housing standards first established to guarantee adequate space for dwelling now prevent the production of smaller and more affordable units in cases where that would seem useful (for instance in high-priced real estate markets). On the level of urban design, architects also face the challenge of passing their proposals through a legal corridor of zoning plans and design charters. If architects decide to go against these rules, they are often punished by either having their schemes disqualified from their respective competitions or by being forced to run their designs through a bureaucratic mill that finally spits them out as something entirely different – just remember the pathetic fate of Nicholas Grimshaw’s Chamber of Trade and Industry in Berlin, which on the side facing the street was crudely trimmed to match the standard 22m eaves line of Berlin’s traditional perimeter block.
But there is no point in lamenting over codes and regulations. Architects need to engage more actively in the process of defining the rules. For they are obviously not god-given, but made by people with particular interests. If in the beginning this was the task of our law makers, acting as representatives of society, recently we see lobbyists of the building industry to take an ever more poweful role. It’s not rare that they actually write new regulations which are then only waved through by politicians before becoming actual law. German regulations for saving energy (EnEv), for example, obligingly acts in the interests of the national building insulation industry. In this way, nearly every industrial lobby has managed to slide their particular agenda in some code or other over the past few decades. The result is a tangled mess of regulations that complicates the once archaic act of building, now beyond recognition. Increasingly, architects spend most of their time pushing their project’s one great idea through a vicious labyrinth of paragraphs defined by communes, the state, even the EU. There are increasing calls to stop the endless the proliferation of restrictions. And therefore we ask: Does good architecture need regulations?
Ja ...
Nein ...
Nein ...
Nein ...
Ja ...
Ja ...

Ja ...
Jein ...
Ja ...

Nein ...
Nein ...

Ja ...
Ja ...
Jein ...
Ja ...
Ja ...
{Deutsche Übersetzung} Ulrich Beck zufolge haben wir eine Stufe der industriellen Entwicklung erreicht, in der wir weniger darauf bedacht sind, das befreiende Potenzial technologischer Produktivität weiter auszureizen, sondern eher die in diesem Potenzial schlummernden Risiken und unbeabsichtigten Nebeneffekte zu bändigen. Die Kausalitätszusammenhänge dieser Effekte und Risiken – der Klimawandel sei hier beispielhaft genannt – sind für den Einzelnen oft nicht mehr wahrnehmbar, so dass wir auf Experten aller Art – von Wissenschaftlern bis Regulierungsbehörden – angewiesen sind, uns diese Risiken klar zu machen und uns für unser kollektives Handeln Empfehlungen zu geben. Der wachsende Umfang und die zunehmende Komplexität von Bauvorschriften ist ein Index dieser historischen Verlagerung, der Reflexivität zeitgenössischer Praxis. Während die moderne Bewegung die Architektur noch aus den neuen technologischen Möglichkeiten des Bauens entwickeln wollte, sind die Möglichkeiten zeitgenössischer Architektur scheinbar in einem Netzwerk aus Normen, Vorschriften und Richtlinien gebunden, was die Tätigkeit des Architekten, Kunden und Bewohners zwangsläufig einschränkt.
Über diesen zunehmend komplexen Behördenapparat kann man durchaus besorgt sein. Regularien bilden ja kein wertneutrales, technisches Dokument, sondern bringen ihre eigenen und zwangsläufig beschränkten Formen von Sichtbarkeit, Denkweisen, Ethik und Subjektivität mit sich. Wir könnten daraus durchaus schlussfolgern, dass Bauvorschriften als System grundsätzlich fehlerhaft sind und sie die Architektur in einer wirtschaftlichen Logik gefangen halten. Denn während Beck die „Risikogesellschaft“ als einen Prozess der „Vergesellschaftung“ von Wissenschaft ansieht, scheinen Vorschriften sich an „produktivitätssteigernden Erkenntnisinteressen“ zu orientieren: Sie werden meist von Leuten definiert, die von den Risiken profitieren und eher neue Wirtschaftszweige aus ihnen erzeugen wollen als sie zu verdrängen.
Trotzdem sollten wir uns auch das gemeinschaftbildende Potenzial dieser selbstauferlegten Beschränkungen vor Augen führen: Wir definieren die Bauvorschriften, die wir als so einschränkend empfinden. Und insofern erweisen sich Bauvorschriften als ein Werkzeug, mit dem die Architektur sich mit einer Reihe von biologischen, soziologischen und ökologischen Grenzen konfrontieren kann. Und erst durch diese Grenzerfahrung werden wir fähig zu unserer eigenen „Impotentialität“.
(Anmerkung der Redaktion: Impotentialität ist ein Begriff, den der italienische Philosoph Giorgio Agamben in die Diskussion eingefährt hat. Potentialität bezeichnet die Fähigkeit, etwas zu tun. Impotentialität beschreibt die Fähigkeit, etwas nicht zu tun. Diese Fähigkeit zeichnet den Menschen gegenüber dem Tier aus, welches einem Impuls (z. B. dem, ein anderes Tier zu fressen) reflexhaft folgt, während der Mensch demselben Impuls durch seine Fähigkeit zur Reflexion widerstehen kann.)
Liam Ross ist Architekt und Dozent für architektonisches Entwerfen an der ESALA. Er studierte an der University of Edingburgh und der Architecture Association und hat Praxiserfahrung in Edinburgh, London und New York, wo er an Projekten für Großbritannien, den USA, Russland und den VAE arbeitete. Er erhielt eine Reihe von Auszeichnungen für seine Entwürfe und stellte seine Arbeiten im Feld der Design-Forschung im britischen Pavillon auf der Biennale in Venedig 2012 und der RIBA aus. http://sites.ace.ed.ac.uk/liamross
2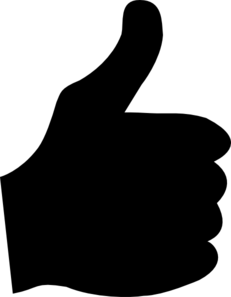
0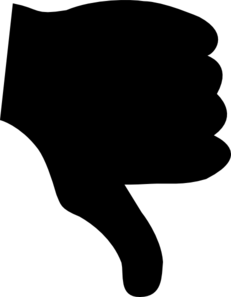
0


